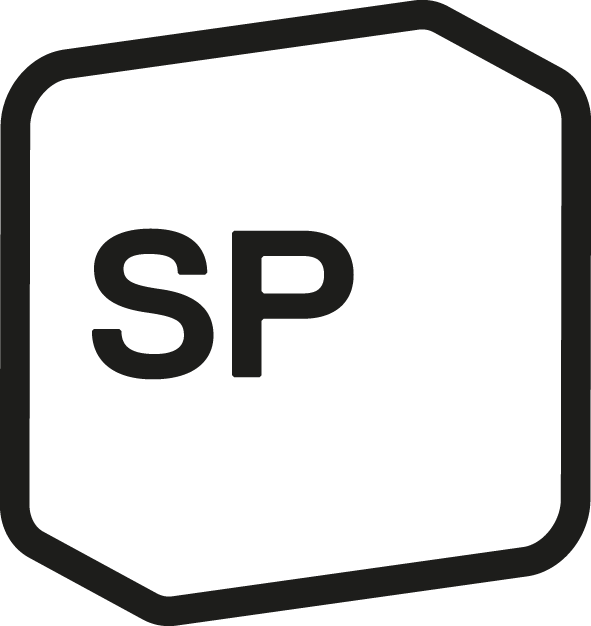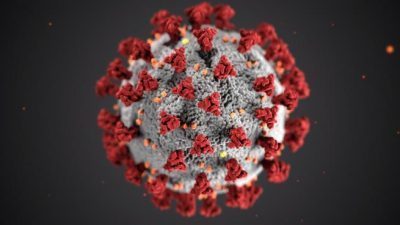Eine Analyse von Fabian Molina:
Das Coronavirus trifft uns alle, vom Banker über die Pflegefachfrau bis zur Coiffeuse. Und trotzdem offenbart uns das Virus gesellschaftliche Ungleichheiten und gravierende Fehler in unserem Wirtschaftssystem. Obwohl das Sozialleben aller Menschen massiv eingeschränkt wurde und viele über Home-Office arbeiten, müssen Industriearbeiter_innen und Dienstleistungsangestellte nach wie vor arbeiten und sind dem Virus dementsprechend mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt. Obwohl die Schweiz eines der reichsten Länder der Welt ist, sind auch bei uns Spitäler ausgelastet, Pfleger_innen unterbezahlt und fehlen medizinische Geräte und vieles mehr. Und obwohl die Wirtschaft still steht, leiden vor allem die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen unter finanziellen Sorgen. Was für Lehren ziehen wir daraus?
Obschon noch unklar ist, welches Ausmass die Pandemie in der Schweiz annehmen wird, steht eines fest: Die aktuelle Situation in den Spitälern, die Finanzspritzen des Bundesrates an die KMUs und der Ausnahmezustand in den Flüchtenden-Camps in Griechenland sind kein Zufall, sondern die Konsequenz politischer Entscheidungen der letzten Jahre. Über Jahrzehnte haben uns Staaten und die Wirtschaft eingetrichtert, wir müssten die Produktion von Waren und Gütern Privaten überlassen, Spitäler müssten wie Unternehmen geführt, Böden Rendite abwerfen und die Wohnungsmärkte den Investoren überlassen werden. Spätestens jetzt, in der Corona-Krise, haben viele gemerkt, dass unsere Produktions- und Lebensweise nicht krisenresistent ist.
Deshalb ist klar: Es braucht Alternativen zum Status Quo. Die Grundversorgung muss in öffentlicher Hand sein, damit sie der ganzen Bevölkerung, unabhängig von Einkommen, Geschlecht oder Herkunft zur Verfügung steht. Um Menschenleben, Lebensqualität und Wohlstand in Zukunft besser zu schützen, braucht es eine dauerhafte Stärkung der Werte, die uns aktuell durch die Krise bringen: Solidarität, kollektives Handeln und Kooperation. Unser Wirtschaften muss radikal umgekrempelt werden, damit der Wohlstand allen Menschen zugute kommt und an den Landesgrenzen keinen Halt macht. Während der Krise zeigt sich, dass eine andere Wirtschaft möglich ist. Warum sollten wir angesichts von Klima-Krise, steigender Ungleichheit und globaler Konflikte zur alten Form zurück? Eine zukunftsfähige Wirtschaft muss sich an solidarischen, ökologischen und demokratischen Massstäben orientieren.
Wie das konkret aussehen könnte? Und wo zeigt sich das Versagen der bisherigen Wirtschaftsweise in der aktuellen Krise? Ein Analyseversuch:
Die Coronakrise bringt international alle Gesundheitssysteme an ihren Anschlag. In der Schweiz fehlen Schutzmasken, in Italien müssen kubanische Ärzt_innen eingeflogen werden, um das ausgelastete Medizinpersonal zu unterstützen und in Ländern des globalen Südens fehlen noch mehr Beatmungsgeräte als in den reichen Staaten des Nordens. Die grösste Befürchtung ist, dass die Pandemie zum Kollaps der Gesundheitssysteme führt. Dies würde bedeuten, dass auch Nicht-Infizierte in Intensivstationen nur schwer bis gar nicht versorgt werden könnten. Bereits jetzt melden Regionen wie Norditalien, dass sie Patient_innen ins Ausland verlegen müssen, weil die Spitäler ausgelastet sind. So dramatisch die Situation auch sein mag, so ist es doch erstaunlich, wie unvorbereitet die reichen Staaten sind. Denn gerade diese mit hohen Bruttoinlandprodukten sollten doch genügend finanzielle Ressourcen haben, um auch in Zeiten einer Pandemie den Schutz ihrer Bevölkerung garantieren zu können. Betrachtet man jedoch, wie viel Staaten für die Gesundheit ausgeben, wird schnell klar, warum sie momentan an ihre Grenzen stossen. Die Schweiz gibt jährlich 6,4 Prozent ihres Haushaltsbudgets für die Gesundheit aus[1]. In den letzten Jahren hat die Schweiz dutzende Spitäler geschlossen und tausende Betten abgebaut. Die Devise für Spitäler war immer: schlanker, unternehmerischer – und krisenanfälliger[2]. Im Ausland sieht die Situation nicht anders aus. In den USA haben knapp 30 Millionen Menschen keine Krankenversicherung[3], was bedeutet, dass diese Menschen erst in der Notaufnahme landen, wenn sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Im globalen Süden sieht es noch viel dramatischer aus, denn dort können Staaten weder bei hohen Kosten Finanzspritzen sprechen, noch können tausende Menschen die auf engstem Raum leben, in Quarantäne gebracht werden. Daraus wird ersichtlich: Die Mängel im Gesundheitssystem sind die Konsequenz jahrelanger neoliberaler Abbaupolitik, was sich jetzt rächt. Doch das Coronavirus führt den Menschen ebenfalls vor Augen, dass Politik nicht innerhalb von Nationalstaaten gedacht werden kann, denn kollabiert das Gesundheitssystem eines Staates, dehnt sich die Pandemie nur noch rascher global aus.
[1] https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/oeffentliche-haushalte.assetdetail.11708557.html
[3] https://www.zeit.de/2020/14/coronavirus-usa-gesundheitssystem-versicherung-versorgung
Auch nebst der Ausnahmesituation in den Spitälern zeigt die Corona-Krise exemplarisch, dass die Systemrelevanz von Berufen bisher falsch gedacht wurde. Der Grossteil der Arbeit in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen wird von Frauen geleistet. Sie halten die Gesellschaft am Laufen, da sie in denjenigen Berufsgruppen arbeiten, die existenzielle Lebensbereiche umfassen[1]. Gleichzeitig arbeiten sie aber auch in denjenigen Berufen, die mit extrem hohem Stress, Überstunden und schlechtem Lohn verbunden sind. Nachdem der Bundesrat in Anbetracht der Krise mittels einer Verordnung das Arbeitsgesetz für das Gesundheitspersonal ausser Kraft gesetzt hat, ist das Gesundheitspersonal bezüglich seiner Ruhezeiten und Höchstarbeitszeit nicht mehr gesetzlich geschützt. Für das Privatleben der Betroffenen ist das eine Katastrophe. Um Lohn- und Care-Arbeit dauerhaft in ein besseres Gleichgewicht zu bringen, braucht es eine Verkürzung der Lohnarbeitszeit für alle. Dass die Politik nach der Krise insbesondere auf die Situation in den prekären Berufen reagieren muss, scheint selbstverständlich. Lohnerhöhungen, mehr ausgebildetes Personal und bessere Arbeitsbedingungen müssen mindestens garantiert werden. Doch die Situation in den Spitälern und Pflege-Institutionen muss grundlegend neu gedacht werden. Es braucht eine Demokratisierung der Care-Arbeit. Pflege darf nicht als Privatsache, sondern muss als gesellschaftlich, solidarisch zu tragende Arbeit betrachtet werden[2]. Ein erster Schritt kann durch mehr Mitspracherecht der Pfleger_innen in ihrer Arbeit getan werden. Weiter müssen auch Spitäler in privater Hand kritisch betrachtet werden. Die Corona-Krise zeigt, dass ein gewinnorientiertes Unternehmen die Bedürfnisse der Menschen in der Pflege und der Patient_innen nicht sichern kann. Nur eine Einrichtung in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand, welche demokratischer Kontrolle unterliegt und auf Solidarität basiert, kann auf die Sorgebedürfnisse der Menschen eingehen.
[1] https://de.statista.com/infografik/21148/anteil-der-sozialversicherungspflichtig-beschaeftigten-nach-wirtschaftszweigen/
[2] http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2019/05/20_Care_Revolution_Neumann_Winker.pdf
Die Pharmaindustrie hat es bisher noch nicht geschafft, ein Medikament gegen COVID-19 herzustellen. Während Staaten auf sichere Schnelltests warten und die Pharmaindustrie sowie zahlreiche Hochschulen forschen, stellt sich für die Bevölkerung die Frage, ob sie sich testen kann und in vielen Staaten ebenfalls, ob die Krankenkasse diesen Test bezahlt. Pharmakonzerne forschen grundsätzlich bloss in den Bereichen, in denen sie Profite wittern. Das ist vor allem der Bereich der neu patentierbaren Medikamente und nicht die Entwicklung von Impfstoffen. Dass dies nicht zum Wohle der Menschen ist, zeigt die Corona-Krise deutlich. Zusätzlich stellt sich die Frage, warum überhaupt Unternehmen Forschung nur für ihre Profite betreiben dürfen und keinerlei Transparenzpflicht unterstehen. Medikamente schützen die Menschen vor Krankheiten, gehören somit zu ihren Grundbedürfnissen. Wenn Konzerne hohe Preise für Medikamente festlegen, setzen sie Menschenleben aufs Spiel, da sie in Kauf nehmen, dass sie nicht für alle bezahlbar sind. Deshalb ist es fundamental, dass privatwirtschaftliche Unternehmen in Kollaboration mit Universitäten forschen. Nur so kann garantiert werden, dass wissenschaftlicher Fortschritt allen zugute kommt. Gleichzeitig muss die Politik sich fragen, ob Medikamente von Privaten hergestellt werden sollten. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen umeinander kümmern, verwehrt niemandem den Zugang zu Medikamenten – eine Kollektivierung von Medikamenten wäre somit der einzig nachvollziehbare Schluss aus der Corona-Krise, damit niemandem mehr ein Schnelltest oder eine Tablette verwehrt bleibt.
Wir alle brauchen Wohnraum zum Leben, genauso wie wir alle Luft, Nahrung und Wasser brauchen. Heute liegt die Macht über diese wichtige Lebensgrundlage hauptsächlich in den Händen von Privaten. Auch bei Wohnungen handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Gut, denn Eigentum an Wohnungen ist immer untrennbar verknüpft mit dem Eigentum am Boden, auf dem diese errichtet wurden. Dies offenbart sich auch anhand der Corona-Krise. Denn Menschen, die ihren Job verlieren, geraten gleichzeitig auch in Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren. Auch die Fakten in der Schweiz belegen dies. Nur gerade 38 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Wohneigentümer_innen[1]. Bei Einwohner_innen ohne Schweizerpass ist dieser Anteil mit 13 Prozent sogar noch geringer[2]. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass Menschen mit tiefem und mittlerem Einkommen während der Corona-Krise oft Lohneinbussen hinnehmen müssen, beispielsweise in dem sie in Kurzarbeit gedrängt werden. Aus diesem Grund hat er beschlossen, dass der Zahlungsverzug von Mieten von 30 auf 90 Tagen angehoben wird. Obwohl diese Massnahmen für Mieter_innen begrüssenswert sind, löst dies die Probleme nicht. Die Miete muss dennoch zu gleichen Kosten beglichen werden. Bereits vor der Corona-Krise gaben Mieter_innen, die weniger als 4'000 Franken im Monat verdienen, oft fast 35 Prozent des Einkommens[3] für Wohnraum aus.
Eine fundamentale Rolle in der Boden- und Wohnpolitik spielt aber vor allem das Grosskapital. Etwa 39 Prozent aller Wohnungen sind heute im Besitz von Baufirmen, Banken und institutionellen Anleger_innen, wie “SBB Immobilien”, Pensionskassen und Versicherungen[4]. Ist Boden im Besitz von Banken oder Pensionskassen bedeutet dies, dass die Menschen Spekulation und hohen Mieten ausgesetzt sind. Dabei sollte doch die Entscheidungsgewalt über ein Gut wie Boden in den Händen derjenigen Menschen liegen, die vom Umgang mit Boden direkt betroffen sind. Genossenschaften zeigen bereits heute, dass solche Wohnformen funktionieren, weil die Menschen demokratisch darüber entscheiden können, was mit ihrer Wohnung und dem Boden passiert. Niemand sollte seine Miete nicht zahlen können, geschweige denn seine Wohnung verlieren. Die Politik muss diese Lehren aus der Corona-Krise ziehen, damit niemand in der Schweiz durch hohe Mietpreise in Not gerät. Die Lösung hierfür ist, dass die Menschen demokratisch über den Boden bestimmen können und nicht die Banken oder Pensionskassen.
[1] https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen.html
[2] https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/zahlen-und-fakten/wohneigentumsquote.html
[3] https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/zahlen-und-fakten/mietbelastung.html
[4] https://www.mieterverband.ch/mv/mitgliedschaft-verband/zeitschrift-mw/artikel/2019/Das-Geschaeft-mit-den-Mieten.html
Für viele Menschen war zu Beginn der Corona-Krise nicht klar, ob sie weiterhin zu genügend Nahrungsmittel kommen würden. Obwohl der Bundesrat stets betonte, dass keine Lieferengpässe bestünden, waren die Regale mit Desinfektionsmitteln und Lebensmitteln aufgrund von Hamsterkäufen schnell leergeräumt. Während Detailhandelsangestellte Überstunden leisteten, um die Lebensmittel nach und nach in den Läden aufzufüllen, blockierten Staaten an den Landesgrenzen ihre Güter, um sie der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Abgesehen davon, dass es absurd ist, dass Staaten in einer Pandemie in Nationalismus verfallen, weil das Virus keine Grenzen kennt, muss sich die Schweiz Gedanken über ihre Grundversorgung von Lebensmitteln machen. Die Krise offenbart, dass die Theorie der komparativen Kostenvorteile schwächelt, wenn Staaten Handelshemmnisse erheben. Die Bevölkerung will aber auch in Krisenzeiten qualitativ hochwertige Lebensmittel beziehen und keine Angst davor haben, dass gewisse Produkte fehlen. Der Ansatz, die bestehenden Probleme auch in Anbetracht der Klimakrise anzugehen, ist, die nachhaltige Produktion zu stärken und lokale Ernährungskreisläufe zu fördern. Durch lokale Produktion und lokalen Konsum sinken Treibhausgasemissionen von Transport und Lagerung. Die Wertschöpfung bleibt zudem in der Region und schafft so Arbeitsplätze. Die Schweiz hat hervorragende Ackerböden und ein – zumindest noch – günstiges Klima. Wegen der Klimaerwärmung und falscher Bewirtschaftung wird beides weltweit immer mehr zur Seltenheit. Nur schon deshalb ist die Schweiz verpflichtet, auch in Zukunft einen relevanten Anteil ihrer Nahrung selbst zu produzieren[1].
Handel und Produktion können allerdings nicht bloss lokal oder national geschehen. Die Schweiz liegt, auch wenn sie nicht Teil der Europäischen Union ist, im Herzen Europas. Sie ist abhängig von Importen und Exporten. Dementsprechend ist auch internationaler Handel relevant, um Grundbedürfnissen der Bevölkerung nachkommen zu können. Die zentrale Frage dabei ist allerdings, auf wessen Kosten internationaler Handel geht und ob die Menschen die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, unter welchen Bedingungen Handel betrieben wird. Die Schweiz ist in den letzten Jahren verschiedene dubiose Freihandelsabkommen eingegangen. Das bürgerliche Parlament hat im internationalen Handel jeweils nur ein Kredo: Profit für die Schweizer Wirtschaft über alles. Dass dabei Menschenrechte oder die Versorgungssicherheit in anderen Ländern, vor allem im globalen Süden, verletzt und dass dabei keinerlei umweltpolitische Standards festgelegt werden, ist absolut untragbar. Momentan ist aufgrund des Virus fast alles stillgelegt. Doch sobald das Parlament wieder tagen wird, werden die Rechten weiterhin versuchen, die Handlungsfähigkeit des Staates einzuschränken und die Macht über den internationalen Handel Konzernen zu übertragen. Und dabei Menschen andernorts in die Verknappung von lebensnotwendigen Gütern zu zwingen. In Zukunft muss gelten: Die demokratische Kontrolle der Völker über ihre Produktion und ihre Lebensgrundlage muss immer im Zentrum stehen.
[1] http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2019/12/Dyttrich_Thesen_Agraroekologie.pdf
Die Corona-Krise zwingt alle zu Selbst-Isolation. Büros werden geschlossen, Social-Distancing wird zur Pflicht. In Italien drohen sogar Gefängnisstrafen, wenn Lockdown-Regelungen nicht eingehalten werden. Der Zwang zur Isolation ist keine politische, sondern eine gesundheitliche Frage, da sind sich alle einig. Wir müssen die Schwachen und Verletzlichen unserer Gesellschaft vor dem Virus schützen, daher sind Quarantäne-Massnahmen unabdingbar.
Was allerdings vergessen geht: Die Corona-Krise ist nicht die einzige auf der Welt. Denn während der globale Norden sich fragt, wann die Wirtschaft wieder ihren Alltagsgeschäften nachgehen kann, hungern weiterhin Menschen im globalen Süden, spüren die Auswirkungen der Klima-Krise oder flüchten vor Krieg. Auch die Bekämpfung des Virus ist in gewissen Regionen praktisch unmöglich[1]. In Brasilien leben Millionen von Menschen ohne sauberes Trinkwasser in Favelas. In den Slums von Nairobi ist Social-Distancing unmöglich. Die Situation in Camps mit Tausenden Migrant_innen ist genauso dramatisch. In Moria auf Lesbos leben rund 20’000 Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch hygienische Mindeststandards sind unmöglich einzuhalten. Der globale Norden, allen voran Europa, kann diese Umstände nicht ignorieren, da die Pandemie bekämpft werden muss. Solidarität ist das Gebot der Stunde. In der Schweiz organisieren sich zahlreiche Lokalgruppen und zeigen sich solidarisch mit den Risikogruppen, gehen für ältere und hilfsbedürftige Menschen einkaufen. Das exemplarische Verhalten muss sich die Politik zu Herzen nehmen, denn nur die Weltgesellschaft als Ganzes kann die Corona-Krise bekämpfen. Um künftige Krisen zu lösen, müssen die internationalen Organisationen gestärkt sowie reformiert und demokratisiert werden. Nur so wird die Kooperation auf Augenhöhe gefördert. Reiche Staaten, die überdurchschnittlich von der Globalisierung der letzten Jahre profitiert haben, müssen sich finanziell entsprechend grosszügig bei der Bewältigung von Krisen engagieren.
[1] https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-pandemie-krisenregionen-vereinte-nationen
Das Coronavirus trifft die Menschen nicht nur in ihrem Alltag. Es trifft die Menschen vor allem in ökonomischer Hinsicht. Seit dem globalen Ausbruch des Coronavirus sind die Aktienmärkte auf Achterbahnfahrt. Aufgrund der verordneten Sicherheitsmassnahmen der Regierungen, um die Pandemie einzudämmen, können viele Firmen nicht mehr produzieren. Zudem bleiben ihre Kund_innen aus, wodurch die Einnahmen wegfallen. Haben Unternehmen keine Einnahmen mehr, können sie die Löhne ihrer Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen. Laut OECD-Schätzungen drückt die Corona-Krise die Volkswirtschaften reicher Staaten derzeit um 20-25 Prozent[1]. Die Schweizer Wirtschaft schlittert derzeit in eine Rezession. Um die Wirtschaft zu unterstützen, hat der Bundesrat schrittweise ein Massnahmenpaket von rund 62 Milliarden zusammengestellt. Das Ziel der Massnahmen ist, die Beschäftigung zu erhalten, Löhne zu sichern und Selbständige aufzufangen. Das Geld soll über die Schweizer Banken in Form von Krediten verteilt werden. Der Bund übernimmt dafür entweder die volle Haftung (bis 500'000 Franken) oder bürgt mit 85 Prozent (bis 20 Millionen Franken). Die Banken bestimmen, wer wie viel Kredit bekommt – und der Staat trägt das Risiko. Für die Banken ist es eine Win-win-Situation. Denn auch sie sind von der Corona-Krise stark betroffen. Der Aktienkurs der Credit Suisse etwa ist so tief wie noch nie. Die Banken müssen befürchten, dass viele Firmenkredite nicht mehr zurückbezahlt werden können. Es drohen Milliardenverluste. Für die Banken sind die Massnahmen des Bundesrats praktisch, denn als Teil des Pakets werden Bankenregulierungen gelockert und die Banken vom Staat abgesichert, ihren Schuldner_innen neues Kapital zu verteilen[2]. Dass der Bundesrat Massnahmen ergreift, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern ist wichtig und richtig. Doch grenzenlos Geld ins System zu pumpen ist genau dieselbe Massnahme, die bereits während der Finanzkrise von 2008 ergriffen wurde und zum Kollaps des Systems geführt hat. Das Geld, das die Zentralbanken derzeit aus allen Rohren feuern, dient dazu, die Zinsen für Menschen, Firmen und Staaten tief zu halten. Mit den Milliarden, die die Regierungen der USA, Deutschlands oder der Schweiz bereitstellen, sollen die Schulden tatsächlich bezahlt werden: Falls Unternehmen ihre Kredite der Bank nicht mehr zurückbezahlen können, sollen die Steuerzahler_innen den Verlust übernehmen. Dafür werden sich die Staaten wiederum bei den Banken verschulden müssen[3]. Um das zu verhindern, sollte der Staat das Geld bei jenen holen, die es in den letzten Jahren angehäuft haben: Erstens müssen diesmal die Banken, Vermögensverwalter_innen, Immobilieninvestor_innen und Grosskonzerne, die in den letzten Jahren Milliarden an Gewinnen ausgeschüttet haben, ihre Verluste selber tragen – durch eine geordnete Abschreibung der Schulden oder eine drastische Erhöhung der weltweiten Steuern für Konzerne und Vermögende.
Zweitens: Wenn CO2-Schleudern wie Energiekonzerne, Autohersteller oder Airlines wie die Swiss Geld erhalten, dann unter der Bedingung, dass sie sich neu erfinden und ökologischer werden. Zudem muss das Geld von Konjunkturpaketen an Firmen fliessen, die helfen, den CO2-Ausstoss zu senken. Vor allem aber muss die Politik einen Diskurs über die unendliche Wachstumslogik der Wirtschaft führen. Wollen wir alle zehn bis zwanzig Jahre in eine Wirtschaftskrise stürzen, oder wollen wir nach der Corona-Krise unsere Wirtschaft so umfunktionieren, dass sie den Menschen und der Umwelt und nicht den Konzernen dient?[4]
[1] https://www.nzz.ch/wirtschaft/der-wirtschaftseinbruch-kostet-die-schweiz-etwa-15-milliarden-franken-pro-monat-ld.1548873
[2] https://www.woz.ch/2013/kommentar-zum-milliarden-hilfspaket/der-zwanzig-milliarden-schwindel
[3] https://www.woz.ch/2013/weltwirtschaft/willkommener-suendenbock
[4] https://www.woz.ch/2013/kommentar-zum-milliarden-hilfspaket/der-zwanzig-milliarden-schwindel
Das Coronavirus zwingt grosse Teile der Bevölkerung zuhause zu bleiben. Die Kinderbetreuung wird dementsprechend für viele eine noch grössere Herausforderung. Denn während viele Menschen nach wie vor via Home-Office arbeiten müssen, sind die Kinder ebenfalls zuhause und müssen betreut werden. Für die meisten Paare bedeutet das Virus allerdings auch, sich die Kinderbetreuung selbst untereinander aufteilen zu können, was so viel wie eine Elternzeit à la Corona ist. Ohne Krise sind die Regeln klar: Frauen haben Anspruch auf 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, Männer sollen zwei Wochen Vaterschaftsurlaub erhalten. (Gegen das Gesetz läuft allerdings noch von rechtskonservativer Seite das Referendum.) Dies macht weder ökonomisch noch gleichstellungspolitisch Sinn. Die Schweiz muss diese Lehren aus der Coronakrise ziehen. Es kann nicht sein, dass das Geschlecht vorgibt, wer wie lange für die Kinderbetreuung verantwortlich sein muss. Deshalb braucht die Schweiz endlich eine Elternzeit! Zudem dürfen die Lasten für Kinder und Student_innen in der Krise nicht vernachlässigt werden. Gerade für viele Kinder kann die Selbst-Isolation sehr belastend sein, da soziale Kontakte wegfallen. Auch das Lernen wird erschwert, da der Frontalunterricht nur noch online stattfindet. Vor allem für Familien, die auf engem Raum zusammenleben, ist es enorm schwierig, Beruf, Schule und Freizeit gleichzeitig in einer Wohnung zu vereinbaren. Aus diesem Grund müssen die Kantone sich schnellstmöglich darüber Gedanken machen, ob Prüfungen nicht noten- oder abschlussrelevant sein sollten. Kein Schulkind soll benachteiligt aus dieser Krise gehen. Zusätzlich birgt die Corona-Krise die Chance, dass sich Schüler_innen aufgrund erschwerter Umstände stärker in die Gestaltung des Unterrichts einbringen können, damit die Mitbestimmungsmöglichkeiten an Bildungsinstitutionen gefördert werden.
Die Corona-Krise kann und wird Arbeitende in grosse finanzielle Schwierigkeiten bringen. Die Aufgabe des Schweizer Staates ist es, die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen. Die Corona-Krise zeigt eindrücklich, wie wichtig ein starker und gerechter Sozialstaat für alle ist, die von Löhnen und Renten leben. Der Bundesrat hat bereits einige Massnahmen in der Krise ergriffen. So werden Unternehmen mittels Überbrückungskredite unterstützt, Unternehmen wird bei Beiträgen für die Sozialversicherungen einen vorübergehenden zinslosen Zahlungsaufschub gewährt, die Hilfe für Selbständige wird ausgeweitet und die Karenzfrist bei Kurzarbeit wird ganz aufgehoben. Zudem hat der Bundesrat Unterstützungmassnahmen für die Kultur und den Tourismus gesprochen. Die Massnahmen des Bundesrates haben vor allem das Ziel, die Wirtschaft nicht unter der Krise leiden zu lassen. Plötzlich begreift auch die bürgerliche Regierung, dass es die arbeitenden Menschen sind, die den Wohlstand erarbeiten. Deshalb wird Sozialpolitik auch für neoklassische Ökonom_innen auf einmal wichtig. Heute wird für alle ersichtlich, wie wichtig der Schweizer Sozialstaat ist, um Menschen vor Armut zu bewahren. Weil heute mehr Menschen finanzielle Nöte zu spüren bekommen, steigt auch das Verständnis, weshalb die AHV- und IV-Renten erhöht werden müssen. Weil ohne finanzielle Sicherheit kein Leben in Würde möglich ist. Um Menschen dauerhaft soziale Sicherheit zu geben, muss der Sozialstaat dauerhaft gestärkt werden. Es darf dementsprechend in Zukunft keine kantonalen Sonderregelungen in der Sozialhilfe geben. Es braucht ein Rahmengesetz in der Sozialhilfe, damit einzelne Kantone nicht nach blosser Willkür Sozialgelder kürzen können. Zudem wird dadurch der “Race to the bottom”-Wettbewerb zwischen den Kantonen eingedämmt. Langfristig muss jedoch eine breite, öffentliche Debatte über eine allgemeine Erwerbsversicherung geführt werden. Diese würde die Beschränkung von Taggeldern aufheben. Niemand in der reichen Schweiz darf in Angst leben, ausgesteuert zu werden. Eine Erwerbsversicherung würde wichtige Lücken schliessen: Das Krankentaggeld, Ergänzungsleistungen für Familien mit geringem Einkommen, der Einbezug der selbstständig Erwerbenden. Zusätzlich würde sich insbesondere die Lage von Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien und von (Schein-)Selbstständigen verbessern[1].
[1] http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/08/AEV.pdf
In unzähligen Bereichen legt die Corona-Krise das Versagen und die Mängel der alten Ordnung offen. Obige Analyse ist dabei sicherlich nicht abschliessend und wahrscheinlich kommen bis zum Ende der Krise weitere Problemfelder hinzu. Bereits heute lässt sich aber sagen: Eine Wirtschaft, die auf Solidarität, Ökologie und Demokratie anstatt auf Profit und Egoismus beruht, wäre besser auf eine Pandemie vorbereitet gewesen. In der Krise wurden viele Fehler der letzten Jahrzehnte über Nacht korrigiert. Lassen wir nicht zu, dass wir wieder in alte Muster verfallen.